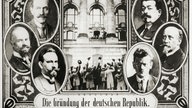Adolf Hitler
Hitlers Weg zur Macht
Von 1933 bis 1945 herrschte Adolf Hitler als Diktator über Deutschland, nachdem er die demokratischen Wahlen gewonnen hatte. Doch wieso wählten ihn die Deutschen überhaupt an die Macht?
Von Andrea Böhnke
Deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg
Ein wesentlicher Faktor für Adolf Hitlers späteren politischen Erfolg waren die Ereignisse des Ersten Weltkriegs. Deutschland war zu dieser Zeit ein Kaiserreich und wurde von Kaiser Wilhelm II. regiert. Er wollte aus dem Deutschen Reich eine Weltmacht machen und beteiligte sich deswegen am Krieg.
Lange Zeit glaubten die Menschen in Deutschland an einen Sieg ihres Kaisers und ihrer Armee. Kriegspropaganda und Politiker ließen auch keinen Zweifel daran.
Es traf sie daher wie ein Schlag, als das deutsche Heer plötzlich kapitulierte. Im September 1918 bot die Oberste Heeresleitung offiziell einen Waffenstillstand an. Die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien gewannen den Krieg.
Der "Schandfrieden" von Versailles
Doch ein großer Teil des deutschen Volkes wollte die militärische Niederlage Deutschlands nicht akzeptieren. Die Menschen suchten nach einem Schuldigen und erfanden verschiedene Verschwörungstheorien.
Eine der bekanntesten stammte von Paul von Hindenburg, dem Leiter der Obersten Heeresleitung und ab 1925 Reichspräsident der Weimarer Republik. Vor dem Untersuchungsausschuss der Weimarer Nationalversammlung behauptete er, die deutsche Armee sei "im Felde unbesiegt" geblieben, aber "von hinten erdolcht worden".
Die Novemberrevolutionäre, die die Umwandlung des deutschen Reiches von einer Monarchie in eine Republik angestoßen hatten, hätten einen Waffenstillstand vereinbart, obwohl der Krieg noch gar nicht verloren gewesen sei. Diese Theorie, die als "Dolchstoßlegende" in die Geschichtsbücher einging, fand bei der Bevölkerung großen Anklang.

Paul von Hindenburg verbreitete die Dolchstoßlegende
Es gab zahlreiche Unruhen, Aufstände und auch eine Revolution. Die Monarchie war am Ende und der Kaiser musste abdanken. Am 9. November 1918 rief der zukünftige Regierungschef Philipp Scheidemann die Republik aus – der Beginn der Weimarer Republik. Zeitgleich zu den nationalen Unruhen musste sich die junge Republik mit den internationalen Friedensverhandlungen auseinandersetzen.
Im Versailler Vertrag legten die Siegermächte die Friedensbedingungen fest. Deutschland bekam die alleinige Kriegsschuld und musste Reparationszahlungen in Milliardenhöhe akzeptieren. Die Siegermächte schrieben zudem eine auf 15 Jahre befristete Besetzung des linken Rheinufers vor. Sie erließen eine Beschränkung der Reichswehr auf 100.000 Berufssoldaten und forderten ein Siebtel des deutschen Territoriums.
Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung war entsetzt, als sie von den Friedensbedingungen erfuhr. Die Menschen sprachen von einem "Schandfrieden", vom "Versailler Diktat".
Doch es gab keine Alternative. Am 28. Juni 1919 unterzeichneten der deutsche Außenminister Hermann Müller und der Verkehrsminister Johannes Bell im Spiegelsaal von Schloss Versailles den Friedensvertrag.

Demonstration gegen den Versailler Vertrag
Radikale Gruppen von links und rechts
Der Unmut der Menschen blieb jahrelang lebendig. Dadurch wuchsen radikale Parteien wie die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Ihre extremen Ansichten kamen beim Volk gut an.
Zudem schürten sie den Rachegedanken gegenüber den Siegermächten des Ersten Weltkriegs. Die Rechten sahen im Versailler Vertrag eine Verletzung der nationalen Ehre. Sie unternahmen Putschversuche, um die Weimarer Republik zu stürzen. Auch die Linken organisierten Aufstände.
1923 erreichte der Kampf um die Machtverhältnisse in Deutschland seinen vorläufigen Höhepunkt: Die hohen Reparationszahlungen hatten zu einer Hyperinflation geführt. Die Bevölkerung zahlte die Rechnung für den Ersten Weltkrieg. Sie verlor ihr Erspartes und gleichzeitig auch das Vertrauen in ihren Staat.
Für die NSDAP und ihren Anführer Adolf Hitler war dies ein guter Zeitpunkt, um ihre Vorstellung einer "legalen" Diktatur zu propagieren. Sie startete einen Putschversuch, an dem unter anderem auch Hitler beteiligt war. Die Aktion blieb allerdings erfolglos.
Als im November 1923 eine neue Währungsreform in Kraft trat, normalisierten sich die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland. Auch auf internationaler Ebene entspannte sich die Lage: Der damalige Außenminister Gustav Stresemann handelte mit den Siegermächten des Ersten Weltkriegs neue Verträge über die Reparationszahlungen aus. Zudem wurde Deutschland Mitglied des Völkerbundes.
Die Weltwirtschaftskrise
Die Stabilisierung der politischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland währte nur kurz. Mit dem "Schwarzen Freitag" von 1929 brach die New Yorker Börse zusammen. Es kam zu einer weltweiten Wirtschaftskrise, die auch Deutschland betraf. Wichtige Kredite aus dem Ausland blieben aus, die Industrieproduktion sank um 40 Prozent und sechs Millionen Menschen wurden arbeitslos. Es kam zu einer Massenverelendung.
Die erneute wirtschaftliche Unsicherheit wirkte sich auch auf die politische Lage aus. Innerhalb von elf Jahren hatte die Weimarer Republik ihren zehnten Regierungschef. Die radikalen Linken und Rechten bekamen immer mehr Zustimmung aus dem Volk.

Viele Menschen waren obdachlos und mussten hungern
Vor allem die NSDAP profitierte von der wirtschaftlichen Not der Menschen. Bei der Reichstagswahl am 14. September 1930 bekam sie sechsmal so viele Stimmen wie noch zwei Jahre zuvor: von 2,6 Prozent auf 18,3 Prozent.
Damit war die NSDAP nach der SPD die zweitstärkste Fraktion im Reichstag. Ihr Vorsitzender Adolf Hitler wurde zum größten Konkurrenten des regierenden Präsidenten Hindenburg.
Hitlers Ernennung zum Reichskanzler
In den Jahren nach der Weltwirtschaftskrise konnte die NSDAP ihre Bedeutung nicht nur auf Regierungsebene weiter stärken. Ihre Anhänger brachten den politischen Machtkampf auch auf die Straßen. Sie ließen den Unmut der Menschen über den verlorenen Ersten Weltkrieg und den Versailler Vertrag wieder aufflammen.
Dadurch schafften sie die Grundlage für die Machtergreifung Adolf Hitlers: Sie propagierten Hitler als Rächer des deutschen Volkes.
1932 versuchten Reichspräsident Hindenburg und Reichskanzler von Papen Hitler für ihre Ziele einzubinden – jedoch ohne Erfolg. Hindenburg wurde letztlich zu Hitlers Steigbügelhalter auf dem Weg zur Macht. Am 30. Januar 1933 ernannte er ihn zum Reichskanzler.
Ohne diese offizielle Handlung hätte Hitler nicht Reichskanzler werden können. Und auch das Volk hatte seine Ernennung vorangetrieben: In der vorangegangenen Reichstagswahl vom 6. November 1932 hatte die NSDAP 33,1 Prozent der Stimmen erreicht. Hitler wurde also demokratisch ins sein Amt gewählt – und schaffte danach in wenigen Monaten die Demokratie ab.

Reichskanzler Hitler
(Erstveröffentlichung: 2013. Letzte Aktualisierung: 08.02.2024)
Quelle: WDR