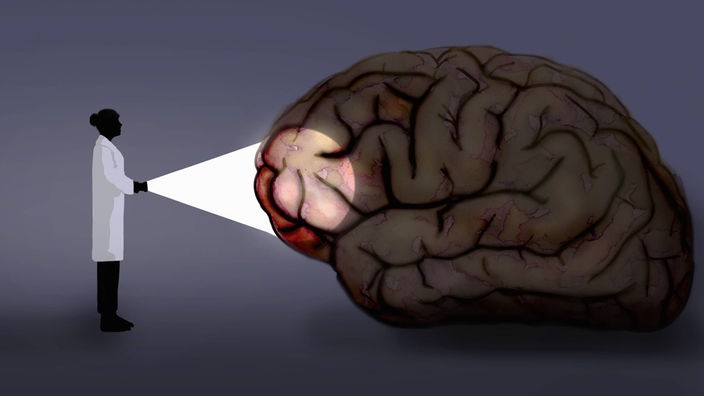
Hirnforschung
Das Gehirn des Mannes
Der berühmte "kleine Unterschied" soll schuld daran sein, dass "Frauen nicht einparken und Männer nicht zuhören können". Obwohl man mit solchen Pauschalisierungen vorsichtig sein sollte, halten sie sich hartnäckig.
Von Katrin Ewert, Andrea Wengel
Das Bild vom starken Geschlecht
Über die physiologischen Unterschiede lässt sich nicht streiten: Männer sind im Schnitt nicht nur zehn Zentimeter größer und entsprechend schwerer als Frauen, sie haben auch eine stärker entwickelte Muskulatur, sind eher zu sportlichen Höchstleistungen fähig – und sie haben ein größeres Gehirn.
Schwieriger wird es bei der Frage, ob dieses männliche Gehirn anders funktioniert als das weibliche. Männer sollen im Schnitt eine bessere räumliche Vorstellungskraft haben (und deswegen auch besser einparken können) und die talentierteren Mathematiker sein.
Dafür gelten sie aber auch als aggressiver und konkurrenzorientierter und – was Frau doch schon immer wusste: Männer denken immer nur an Sex, neigen zur Untreue und halten wahre Gefühle für Schwäche, so das Stereotyp.
Solche Klischees halten sich hartnäckig. Auch wenn diese nicht auf alle Männer zutreffen, lässt sich feststellen: Männer sind in vielerlei Hinsicht anders als Frauen. Aber was steckt dahinter?
Alles eine Sache der Gene, heißt es da oft als Erklärung und dankbar wird das Steinzeitmodell herangezogen. Der Mann, der Jäger. Er erlegt die Beute, manchmal unter Einsatz seines Lebens, und versorgt die Familie mit Fleisch. Schon seit Urzeiten ist ER auf diese Aufgabe vorbereitet und stürzt sich in die Gefahr und ins feindliche Leben.
Die Frau dagegen sorgt für die Nachkommen, verrichtet zusammen mit den anderen Frauen leichte, filigrane Arbeiten und geht allenfalls zum Beerenpflücken aus der Höhle. Immerhin scheint dieses Rollenbild so stabil zu sein, dass es sich über die Generationen der Jahrtausende gehalten hat.
Ein Blick auf die klassische 1950er-Jahre-Familie mag das bestätigen. Allerdings hat sich dieses klassische Rollenbild in unserer Gesellschaft mittlerweile gewaltig geändert.
Bleibt also noch die Frage, ob es wirklich die "egoistischen Gene" sind, die den Mann auf maximalen Reproduktionserfolg programmieren, wie manche Evolutionsbiologen meinen. Oder sind es nicht doch die Umwelt und die Kultur, die den Menschen – und damit den Mann – prägen und ihn zu dem machen, was er letztlich ist?
Diese "Nature-versus-Nurture-Debatte" wurde im 20. Jahrhundert mit Hingabe geführt. Doch welchen Einfluss auch immer die biologischen und soziologischen Gegebenheiten ausüben, der Mann von heute hat einen schweren Stand.
Denn das Bild von dem, was und wie ein "richtiger Mann" sein soll, ist gesellschaftlich längst nicht mehr so klar definiert. Er muss sich auf die Suche begeben und seine Rollen neu finden.

Unsere Steinzeitvorfahren hatten die gleichen genetischen Anlagen wie wir
Keine Frage der Gene
Die Fronten in dieser Debatte, in der die einen die genetischen Anlagen, die anderen die Umwelt für die Unterschiede von Menschen verantwortlich machen, sind durch die heutigen Erkenntnisse zumindest aufgeweicht. Eine Studie von US-amerikanischen Forschern aus dem Jahr 2020 legt nahe, dass die Antwort zwischen den beiden Fronten liegt. Die Wissenschaftler untersuchten die Hirnscans von knapp 1.000 Männern und Frauen und stellten fest, dass sich einige Regionen des Gehirns durchaus unterscheiden.
Bei Frauen entdeckten die Forscher mehr graue Hirnsubstanz im präfrontalen Cortex im Stirnbereich, im darüberliegenden orbitofrontalen Cortex und in Teilen des Scheitel- und Schläfenhirns. Diese Regionen sind dafür zuständig, Aufgaben und Impulse zu kontrollieren und Konflikte zu verarbeiten. Männer besitzen hingegen mehr Volumen in hinteren und seitlichen Arealen des Cortex, welche dafür verantwortlich sind, Objekte und Gesichter zu erkennen und zu verarbeiten.
Die Forscher schlussfolgerten, dass nicht nur die Umweltbedingungen zu den geschlechterspezifischen Unterschieden führen können. Sie sind zumindest zu einem Teil angeboren. Viele weitere Untersuchungen haben sich der Frage angenähert, ob es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, allen voran die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts.
Im Zuge dessen hat sich gezeigt, dass sich seit mindestens 100.000 Jahren am menschlichen Erbgut nichts mehr geändert hat. Unsere Steinzeitvorfahren hatten also die gleichen genetischen Anlagen wie wir sie heute haben. Das bedeutet: Sie hatten schon damals das gleiche Potenzial als Grundlage für die Entwicklung eines Gehirns. Was aber hat sich dann geändert?
Die grundlegende Erkenntnis kommt aus der modernen Hirnforschung: Das Gehirn bildet sich immer so aus, wie man es benutzt und wie es gebraucht wird. Wie viel sich an den heutigen Lebensbedingungen im Vergleich zu denen unserer steinzeitlichen Vorfahren verändert hat, ist unschwer zu erkennen.
Das hoch technologisierte digitale Zeitalter, in dem der Mensch fliegt, Auto fährt und im Internet surft, hinterlässt seine Spuren – auch in unserem Gehirn. Warum aber denken, fühlen und handeln Männer dann so anders als Frauen? Wie groß ist der Einfluss der Gene, wenn es um den Unterschied zwischen den Geschlechtern geht?
Immerhin gehen Männer mit einer anderen genetischen Ausstattung ins Leben. Statt eines zweiten X-Chromosoms haben sie ein Y-Chromosom. "Es gibt kein Gen, das dafür verantwortlich wäre, dass Männer ganz anders aussehen und oft auch ganz anders denken, fühlen und handeln als Frauen", sagt Gerald Hüther, Hirnforscher und emeritierter Professor für Neurobiologe an der Universität Göttingen.
Kurz gesagt: Auf diesem Y-Chromosom steht keine einzige Bauanleitung dafür, wie ein männliches Gehirn zu strukturieren ist. Aber nicht nur die Gehirnstrukturen und die Vernetzung von Nervenzellen, sondern unsere Körpermerkmale werden von Genen bestimmt, die auf den 45 Chromosomen liegen, die beide Geschlechter haben.
Trotzdem besitzt dieses kleine Y-Chromosom die wesentliche Triebfeder für die unterschiedliche Entwicklung der beiden Geschlechter: Es sorgt für die typische männliche Testosteronproduktion. Dieses Hormon ist der kleine Unterschied mit der großen Auswirkung.
Testosteron ist nicht nur für die Entwicklung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale verantwortlich. Es sorgt auch dafür, dass die anderen Körpermerkmale wie Muskelmasse, Wuchs und Skelettbau "männliche Züge" bekommen. Selbst die Art und Weise, wie sich das neuronale Netzwerk des männlichen Gehirns verschaltet, wird von Testosteron beeinflusst.

Testosteron verleiht männliches Aussehen
Das Hormon macht den Mann
Männer würden sich auch dann anders entwickeln, wenn sie exakt das gleiche Umfeld hätten, ist sich der Hirnforscher Gerald Hüther sicher. Sie können sich dem Testosteroneinfluss nicht entziehen, der bereits im Mutterleib ab etwa der zehnten Woche auf den männlichen Fötus wirkt.
Diesem vorgeburtlichen Einfluss des männlichen Geschlechtshormons ist es zu verdanken, dass Jungs bereits mit einem etwas anders organisierten und strukturierten Gehirn auf die Welt kommen als Mädchen.
Hüther vergleicht das Gehirn mit einem Orchester. Was die Besetzung angeht, so ist es bei Männern und Frauen mit den gleichen Instrumenten besetzt. Die hormonelle Ausstattung bewirkt allerdings, dass bei den Männern mehr Pauken und Trompeten in der ersten Reihe sitzen, beim weiblichen Geschlecht sind auf diesen Plätzen eher die harmonietragenden Instrumente vertreten.
Das bedeutet auch: Schon von Anfang an machen Jungs eine etwas andere Musik. Entsprechend können sie mit ihrer anderen Orchesterstruktur manches besser und manches weniger gut als Mädchen.
Unser Gehirn gestaltet sich so, wie es benutzt wird
Die Hirnforschung konnte zeigen, dass unser Gehirn eine lebenslange Baustelle ist. Es reagiert zeitlebens auf die Signale von innen – zu ihnen gehören unsere Hormone – und von außen.
Das Gehirn vernetzt sich, denkt und arbeitet so, wie es benutzt wird. "Es ist wie beim Hausbau", verdeutlicht Gerald Hüther: Jungen und Mädchen haben sozusagen ein unterschiedlich strukturiertes Fundament, obwohl die gleichen Materialien verwendet wurden. Für den weiteren Aus- und Anbau des Hauses liegen also unterschiedliche Voraussetzungen vor. Entsprechend wird auch anders weitergebaut und das Haus erhält eine andere Form.
Um in diesem Bild zu bleiben, sind die Hormone ein Potenzial, das die Gehirnentwicklung, also das Fundament, beeinflusst. Die Umwelt, in die wir hineingeboren werden, entspricht einem Potenzial, das den weiteren Ausbau beeinflusst. Allerdings ist dieses Potenzial Umwelt so reichhaltig, dass es unmöglich ist, alles zu verwenden.
Wir müssen uns also etwas davon aussuchen; natürlich wählen wir das, was uns wichtig ist und was uns bedeutend erscheint. Dieses unterschiedliche hormonell bedingte "Fundament" macht sich bereits sehr früh bemerkbar. Schon als Babys begeistern sich Jungs für andere Dinge – und sind in der Regel stärker nach außen orientiert als Mädchen.
Was genau spielt sich da oben im Gehirn ab? "Wenn man Dinge tut, denkt oder wahrnimmt, die für die eigene Lebensgestaltung bedeutsam sind, werden im Gehirn tiefer liegende emotionale Zentren erregt", sagt Hirnforscher Gerald Hüther. Dadurch werden die aktivierten neuronalen Verschaltungen und synaptischen Verknüpfungen gestärkt und gefestigt.
Wer zum Beispiel gerne den Tennisschläger schwingt, den Umgang mit Tieren liebt, sich für ein Instrument begeistert oder sich an fremden Sprachen erfreut, wird dies in der Regel öfter tun. Das Gehirn passt sich an diesen "wiederholten Gebrauch" an, indem es die entsprechenden neuen Verschaltungen anlegt und ausbaut.

Das Gehirn passt sich an den entsprechenden Gebrauch an
Sind die Nervenbahnen, die im Gehirn aktiviert werden, anfangs noch recht zart, werden sie ähnlich einem Muskel bei zunehmendem Gebrauch immer mehr gestärkt und entwickeln sich zu immer leichter aktivierbaren und "befahrbaren" Straßen. "Das Gehirn ändert sich und dann hat man eben ein anderes Gehirn als vorher", fasst Hüther zusammen.
Das heißt aber auch: Verantwortlich dafür, dass sich ein Gehirn so und nicht anders entwickelt, ist nicht die Umwelt, sondern die eigene Begeisterung. Diese Begeisterung ist die Triebfeder, nach welchen Kriterien sich jeder Mensch zu jeder Zeit und an jedem Ort die Aspekte aus seiner Umwelt aussucht. Heraus kommt eine neuronale Straßenkarte, die sich nicht nur im Allgemeinen von Mensch zu Mensch, sondern auch im Besonderen zwischen Männern und Frauen unterscheidet.
UNSERE QUELLEN
- Spektrum.de: "Lexikon der Neurowissenschaft – Geschlechtsunterschiede aus neurowissenschaftlicher Sicht"
- Scienexx – das Wissensmagazin: "Gehirn von Mann und Frau ist doch verschieden. Volumen der grauen Hirnsubstanz und Genexpression zeigen ein geschlechtsspezifisches Muster" (21.07.2021)
- PNAS / Liu, Siyuan et al.: "Integrative structual, functional, and transciptomatic analyses of sex-biased brain organization in humans" (2020)
Quelle: SWR/WDR | Stand: 18.03.2021, 14:00 Uhr







![Illustration, Ärztin hält ein Plüschherz mit den Symbolen für Frau und Mann | Bildquelle: WDR/imago[M]bhm Illustration, Ärztin hält ein Plüschherz mit den Symbolen für Frau und Mann](http://www1.wdr.de/wdr-migration/gendermedizin104~_v-ARDGrosserTeaser.jpg)
